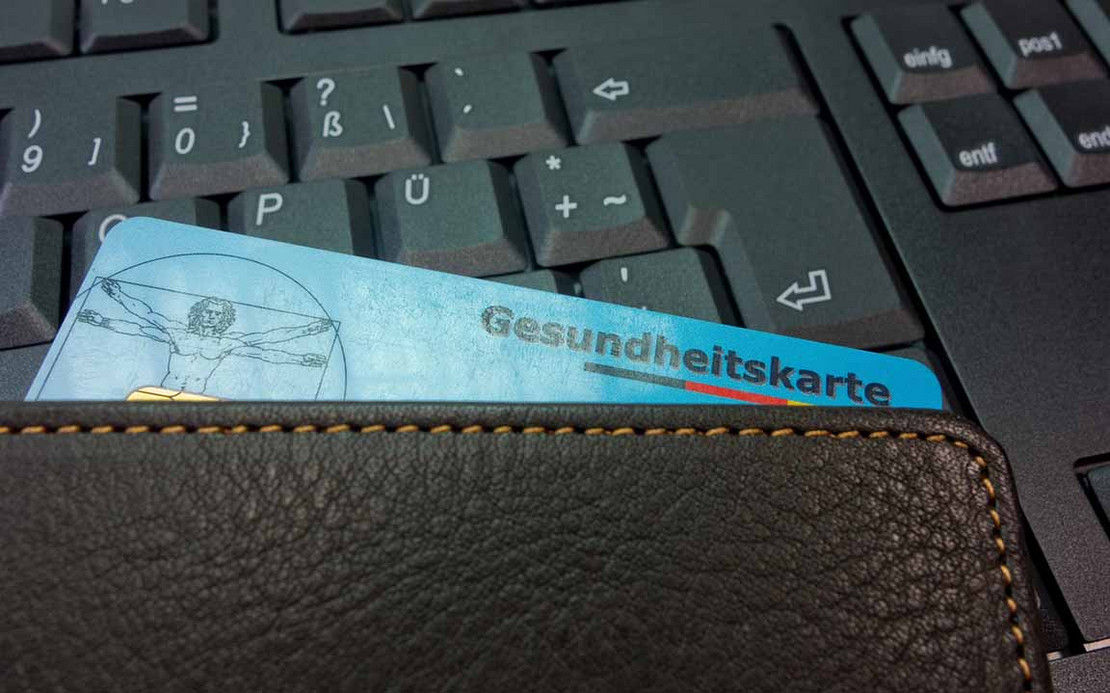Seit Anfang Oktober müssen Ärzt*innen und medizinische Einrichtungen wichtige Gesundheitsdaten wie Befunde, Laborwerte oder Medikationspläne in die elektronische Patientenakte (ePA) ihrer Patient*innen hochladen. Damit sollen Informationen künftig für Versicherte und Behandelnde gleichermaßen sicher und zentral verfügbar sein.
Nach Angaben der staatlichen Digitalagentur Gematik wurden im Oktober bereits 10,6 Millionen Dokumente in die neuen ePAs geladen, insgesamt sind es inzwischen 37 Millionen. Ziel ist, Behandlungen zu verbessern, Doppeluntersuchungen zu vermeiden und die Versorgung transparenter zu machen.
Freiwillig für Versicherte – Pflicht für Praxen
Rund 70 Millionen gesetzlich Versicherte haben inzwischen automatisch eine elektronische Patientenakte erhalten. Wer das nicht möchte, kann jederzeit widersprechen. Die Akte wird dann gelöscht. Für Praxen und Kliniken ist das Hochladen relevanter Daten seit dem 1. Oktober verpflichtend.
Die meisten Arztpraxen, Apotheken und Kliniken sind technisch angeschlossen, doch es gibt noch Startschwierigkeiten. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kommt die ePA im Versorgungsalltag an, „aber der Weg dahin ist holprig“. Vor allem die Telematikinfrastruktur – die geschützte Datenautobahn des Gesundheitswesens – läuft noch nicht immer stabil.
So nutzen Sie die ePA
Die elektronische Patientenakte kann auf verschiedenen Wegen genutzt werden – am Smartphone, Tablet oder auch am Computer.
Nutzung per App:
Jede gesetzliche Krankenkasse bietet eine eigene ePA-App, die in den gängigen App-Stores (Apple, Google, Huawei) heruntergeladen werden kann. Die App funktioniert auf Smartphones oder Tablets mit Android ab Version 10 oder iOS ab Version 16.
Nutzung am PC oder Laptop:
Seit Mitte des Jahres stehen auch Anwendungen für die Nutzung am PC zur Verfügung. Dafür benötigen Versicherte ein geeignetes Betriebssystem (z. B. Windows oder macOS) sowie ein Kartenlesegerät ab Sicherheitsklasse 2 mit eigener Tastatur. Auch hier hat jede Krankenkasse ihre eigene Anwendung, eine Übersicht und Downloadmöglichkeiten gibt es unter https://epaclient.de.
Freischaltung und Anmeldung:
Vor der ersten Nutzung muss die App freigeschaltet werden. Dafür ist ein Identifikationsverfahren nötig – meist mit der NFC-fähigen Gesundheitskarte und PIN oder einer GesundheitsID, die bei der Krankenkasse beantragt werden kann.
Mit der ePA-App können Versicherte:
- Dokumente hoch- und herunterladen, anzeigen, verbergen oder löschen,
- Zugriffsrechte für Ärztinnen und Ärzte festlegen oder widerrufen,
- Widersprüche und Einwilligungen verwalten, etwa zur Datenspende,
- Vertreterinnen und Vertreter benennen, die Zugriff erhalten,
- Zugriffsprotokolle einsehen und die Nutzung beenden.
Nutzung ohne App nur eingeschränkt möglich
Wer kein Smartphone, Tablet oder Computer nutzt, kann die ePA nur passiv verwenden. In diesem Fall legen Ärztinnen und Ärzte, Kliniken oder Apotheken die Daten automatisch ab. Einsehen, verwalten oder löschen können Versicherte diese Daten dann nicht selbst.
Widersprüche oder Änderungen müssen in solchen Fällen über die Ombudsstelle der Krankenkasse erklärt werden. Alternativ kann eine Vertrauensperson benannt werden, die berechtigt ist, Zugriffe zu verwalten. Diese Person kann jedoch keine neuen Vertretungen anlegen oder die ePA löschen.
SoVD: Digitalisierung muss alle mitnehmen
Der Sozialverband Deutschland (SoVD) begleitet die Einführung der ePA kritisch-konstruktiv. Er sieht in der digitalen Patientenakte ein großes Potenzial, Versorgung zu verbessern und Abläufe zu vereinfachen – vorausgesetzt, sie ist patient*innenzentriert, barrierefrei und diskriminierungsfrei gestaltet.
„Gut gemachte Digitalisierung kann die Versorgung verbessern – sie muss aber allen zugänglich sein“, betont der Verband. Datenschutz und Nutzbarkeit seien dabei entscheidend. Gerade Menschen, die mit digitalen Medien nicht vertraut sind, dürften nicht ausgeschlossen werden.